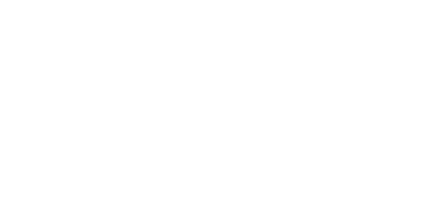Die Ausstellung Einige waren Nachbarn: Täterschaft, Mitläufertum und Widerstand adressiert eine der zentralen Fragen zum Holocaust: Wie war der Holocaust möglich? Die zentrale Rolle von Hitler und anderen Führern der NSDAP ist unbestreitbar. Doch die Abhängigkeit dieser Täter von unzähligen anderen für die Durchführung der NS-Rassenpolitik ist weniger bekannt. Im nationalsozialistischen Deutschland und in dem von Deutschland dominierten Europa entwickelten sich überall, in Regierung und Gesellschaft, Formen von Zusammenarbeit und Mittäterschaft, wo immer die Opfer von Verfolgung und Massenmord auch lebten.
Die Ausstellung untersucht die Rolle der gewöhnlichen Menschen im Holocaust und die Vielzahl von Motiven und Spannungen, die individuelle Handlungsoptionen beeinflussten. Diese Einflüsse spiegeln oft Gleichgültigkeit, Antisemitismus, Karriereangst, Ansehen in der Gemeinschaft, Gruppenzwang oder Chancen auf materiellen Gewinn wider. Die Ausstellung zeigt auch Personen, die den Möglichkeiten und Versuchungen, ihre Mitmenschen zu verraten, nicht nachgegeben haben und uns daran erinnern, dass es auch in außergewöhnlichen Zeiten Alternativen zu Kollaboration und Täterschaft gibt.
Nachfolgend erfahren Sie mehr über die Ausstellung und verfügbare Bildungsressourcen.
Erfahren Sie mehr über die pädagogische Arbeit mit der Ausstellung in diesem Beitrag für den GedenkstättenRundbrief.
Bildungspartner des Museums werden
Mit dieser Ausstellung geht das US Holocaust Memorial Museum eine Partnerschaft mit deutschen Institutionen ein, um diskursive Wege des Lernens vom Holocaust und des Lehrens über den Holocaust anzubieten. Mit der Ausstellung Einige waren Nachbarn will das Museum Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein tieferes Verständnis der Rollen und Handlungen gewöhnlicher Menschen während des Holocaust ermöglichen. Dazur bieten wir Schulungen für Rundgangsleiterinnen und -leiter an, damit diese die Besucher mittels eines partizipativen Lernansatzes in die Erkundung miteinbeziehen können. Bei dieser Herangehensweise unterstützt die Rundgangsleitung durch Dialog, Fragen und Analyse des historischen Materials die Teilnehmenden dabei, die Ausstellung zu erkunden und zu verstehen, wie sich der Holocaust aus der Gesellschaft heraus entwickeln konnte. In diesem Lernprozess spielen die Teilnehmenden eine entscheidende Rolle: Sie erarbeiten sich die Bedeutung der historischen Ereignisse und inwiefern diese für sie im Heute relevant sind.
Das Ausstellungsformat
Diese Ausstellung wird in drei Formaten angeboten: als Version mit Stahl-Paneelen, als Roll-up Version und als Poster-Set bestehend aus 22 Plakaten. Außerdem gehören drei Videos zur Ausstellung. Das Museum arbeitet mit der Gastgeber-Einrichtung an Bildungsangeboten und -aktivitäten hinsichtlich der Ausstellungsziele zusammen. Hier erfahren Sie, wie Sie sich als Gastgeber/in der Ausstellung bewerben können.
Ausstellen der Stahl-Paneele-Version oder der Roll-up-Version:
Siehe Anforderungen an den Gastgeber/in und Bewerbung als Gastgeber/in. Bei Fragen zur Ausrichtung der Ausstellung wenden Sie sich bitte an Dr. Klaus Mueller oder Dr. Aleisa Fishman unter ewn@ushmm.org.
Poster und Videos herunterladen:
Das Museum stellt auch ein Poster-Set der Ausstellung kostenlos für die pädagogische Nutzung zur Verfügung. Hier erfahren Sie mehr über verfügbare Formate und das Herunterladen.
Unterstützung für Ausstellungspartner
Erfahren Sie mehr über die Unterstützung, die das Museum der ausrichtenden Organisation bietet, einschließlich technischer Anweisungen für den Aufbau der Ausstellung, sowie Hilfe bei der Schulung von Rundgangsleiterinnen und -leitern und bei der Pressearbeit. Das Museum wird in enger Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen pädagogische und öffentliche Begleitprogramme entwickeln und zusammen Bildungsziele evaluieren.
Wo kann ich diese Ausstellung besuchen
24. Januar–30.März: Erinnerungsort Torgau
Seit ihrer Eröffnung wurde die Ausstellung in mehr als vierzig Veranstaltungsorten in ganz Deutschland gezeigt und hat ein breites und vielfältiges Publikum erreicht.
Frühere Veranstaltungsorte
Deutscher Bundestag, Berlin: Jan–Feb 2019
In Kooperation mit Miteinander in:
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg: März–April 2019
Stadtbibliothek Gardelegen: September 2019
Landtag von Sachsen-Anhalt, Magdeburg: Oktober 2019
Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz, Berlin: September 2019–Januar 2020
KZ‑Gedenkstätte Neuengamme, Hamburg: November 2019–Januar 2020
In Kooperation mit Villa ten Hompel, Münster, in:
Foyer der Bezirksregierung Münster, Januar–Februar 2020
Volkshochschule Selm-Bork: Januar–März 2020
Stadtarchiv & Volkshochschule, Castrop Rauxel: Januar–März 2020
Bundeskriminalamt, Wiesbaden: Februar–März 2020
Gedenkstätte Alte Synagoge der Stadt Wuppertal: März–Juli 2020
Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf: März–Juni 2020
Gedenkhalle Oberhausen: Mai–August 2020
Städtische Museen Iserlohn: Juli–September 2020
Villa ten Hompel, Münster: Juli–Oktober 2020
Mahn- und Gedenkstätte Steinwache der Stadt Dortmund: September–Oktober 2020
Institut für Stadtgeschichte Stadt- und Vestisches Archiv, Recklinghausen: September–Oktober 2020
Zentrum für Stadtgeschichte, Bochum: Oktober–November 2020
Stadtarchiv / Gedenkstätte Zellentrakt der Stadt Herford: Oktober–November 2020
Foyer der VHS im Kulturzentrum, Herne: Januar–März 2021
Lounge im Theater Krefeld und Mönchengladbach, Krefeld: März–April 2021
NS-Dokumentationszentrum, Köln: November 2020–Mai 2021
Stadtbibliothek Bayreuth: Mai 2021
Stadtmuseum Brakel: April–Juli 2021
Prora-Zentrum Bildung-Dokumentation-Forschung: Juni–September 2021
Europahaus Marienberg, Bad Marienberg: September–November 2021
NS-Dokumentationszentrum Rheinland-Pfalz/Gedenkstätte KZ Osthofen: September – Dezember 2021
Ehemalige Synagoge, Laufersweiler: November–Dezember 2021
Stadtmuseum Altes Rathaus, Pirmasens: November–Dezember 2021
Thüringer Landtag, Erfurt: Januar–Februar 2022
Städtisches Gymnasium Selm: Januar–März 2022
Stadtschloss Eisenach: Januar–März 2022
Deutsches Hygiene-Museum, Dresden: März–Mai 2022
Rathaus, Kassel: April–Mai 2022
Stadtmuseum Coesfeld: April–Mai 2022
Rathaus, Pirna: Mai–Juni 2022
Gedenkstätte Pirna Sonnenstein: August 2022
Gedenkstätte Zellentrakt, Herford: August–Oktober 2022
Neues Rathaus Leipzig: Januar–März 2023
Aktives Museum Südwestfalen e.V., Siegen: Januar–März 2023
Colorido e.V., Plauen: Januar–März 2023
Fachstelle NRWeltoffen im Schulamt des Kreises Minden-Lübbecke: April–Juni 2023
Gemeinde Stemwede/Begegnungsstätte Wehdem: September–November 2023
Partnerschaft für Demokratie Meerane/Heimatmuseum Meerane: Oktober–November 2023
Dokumentationsstätte „Gelsenkirchen im Nationalsozialismus“: Januar–März 2024
Stadtbibliothek Arnsberg Standort Neheim: Januar–März 2024
Amtsgericht Stendal: Juni 2024
Bundeswehr, Territoriales Führungskommando NRW/Kreispolizei Düren: September–Oktober 2024
Miteinander e.V.: September–Oktober 2024
Rathaus, Düren: Oktober–Dezember 2024
Villa ten Hompel, Münster: November–Dezember 2024
Gedenkstätte Feldscheune Isenschnibbe Gardelegen: November 2024
Wir danken unseren Sponsoren
Diese Ausstellung wurde gefördert durch das William Levine Family Institute des United States Holocaust Memorial Museums mit Unterstützung von der David Berg Foundation, der Oliver Stanton Foundation, der William & Sheila Konar Foundation, der Blanche and Irving Laurie Foundation, der Benjamin and Seema Pulier Charitable Foundation, Sy and Laurie Sternberg, und dem Lester Robbins and Sheila Johnson Robbins Traveling and Special Exhibitions Fund established in 1990.